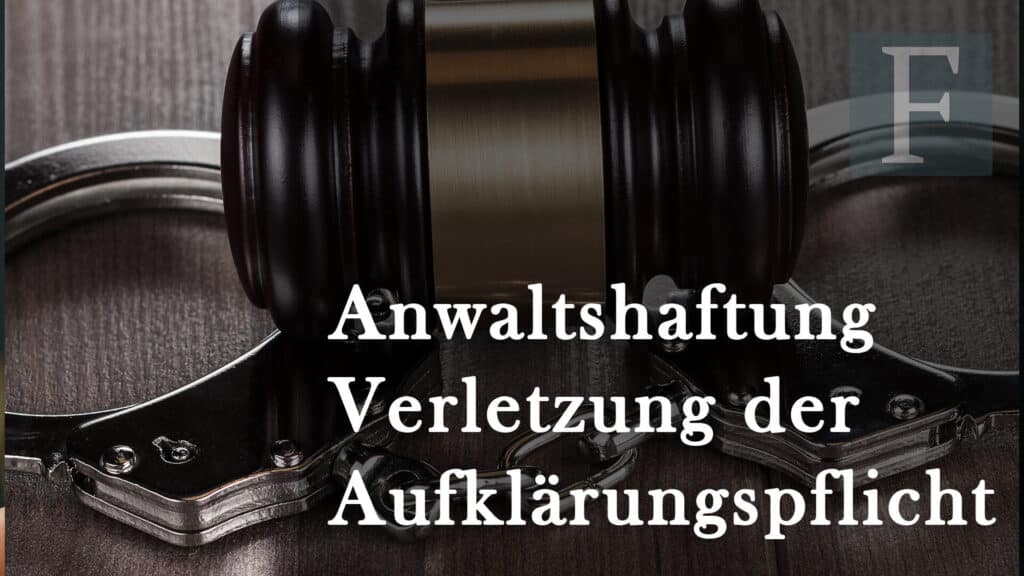Ihr Anwalt hat einen Fehler gemacht – aber haben vielleicht auch Sie dazu beigetragen? In der Anwaltshaftung (Haftung des Rechtsanwalts gegenüber seinem Mandanten) kann in seltenen Fällen Mitverschulden des Mandanten eine Rolle spielen. Das heißt, Anwaltshaftung trotz Mandantenfehler ist zwar grundsätzlich möglich, doch ein eigener Fehler des Mandanten kann den Schadensersatzanspruch mindern oder sogar ausschließen. In diesem Fachartikel erklären wir laienverständlich, was § 254 BGB (Mitverschulden) bedeutet, unter welchen Umständen Mitverschulden bei der Rechtsberatung relevant wird, welche Folgen das hat und geben Beispiele aus der Praxis. Außerdem fassen wir die BGH-Rechtsprechung zum Mitverschulden des Mandanten zusammen und geben Ihnen Tipps, wie Sie Mitverschulden bei der Anwaltshaftung vermeiden können.
Anwaltshaftung – Die Aufklärungspflichten des Rechtsanwalts
Anwaltshaftung bezeichnet die rechtliche Verantwortlichkeit eines Rechtsanwalts, für Schäden einzustehen, die einem Mandanten durch fehlerhafte Beratung oder unsachgemäße Vertretung entstehen. Diese Haftung kann durch verschiedene Pflichtverletzungen ausgelöst werden – von versäumten Verjährungsfristen über die Wahl des falschen Anspruchsgegners bis hin zu einer fehlenden Aufklärung über Erfolgsaussichten und Risiken eines Prozesses. Der Anwalt übernimmt im Mandatsverhältnis nicht nur die Rechtsvertretung, sondern auch eine immense Verantwortung, den Mandanten umfassend zu informieren. Versäumnisse oder Fehler in diesen Aufklärungs- und Beratungspflichten können erhebliche finanzielle Nachteile für den Mandanten zur Folge haben und im Rahmen des Anwaltsregresses (Haftungsprozesses gegen den Anwalt) geltend gemacht werden. Im Folgenden beleuchten wir die Beratungs- und Aufklärungspflichten des Anwalts, typische Haftungsfälle und was Mandanten wie Anwälte beachten müssen.
Umfang der anwaltlichen Beratungs- und Aufklärungspflichten
Ein Rechtsanwalt ist gesetzlich und durch die Rechtsprechung verpflichtet, seinen Mandanten umfassend zu beraten und aufzuklären. Die Beratungspflichten erstrecken sich darauf, den Mandanten in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Dazu muss der Anwalt alle relevanten rechtlichen und tatsächlichen Aspekte des Falls sorgfältig prüfen und dem Mandanten erläutern. Insbesondere hat er proaktiv über verschiedene Vorgehensmöglichkeiten, deren Chancen und Risiken sowie die jeweiligen Konsequenzen aufzuklären – selbst wenn der Mandant von sich aus nur eine bestimmte Option in Betracht zieht. Der Mandant soll durch die Beratung vor vermeidbaren Nachteilen bewahrt und zum bestmöglichen Vorgehen geführt werden.
Zu den wichtigsten Pflichten eines Anwalts im Mandatsverhältnis gehören unter anderem:
- Aufklärung über Risiken und sicherstes Vorgehen: Der Anwalt muss den Mandanten über alle eventuellen Risiken des vorgesehenen Vorgehens informieren und im Interesse des Mandanten den sichersten Weg zum Erfolg empfehlen. Er darf nicht einfach unkritisch den laienhaften Wünschen des Mandanten folgen, sondern muss prüfen, ob dessen Vorstellungen rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll sind und gegebenenfalls bessere Alternativen aufzeigen. So betont der Bundesgerichtshof (BGH) das “Gebot des sichersten Weges”: Der Anwalt hat bei unklarer Rechtslage alle Risiken zu berücksichtigen und den Weg zu wählen, der den Mandanten vor vermeidbaren Nachteilen schützt.
- Einschätzung der Erfolgsaussichten: Ein Anwalt ist verpflichtet, die Erfolgsaussichten einer Klage oder Verteidigung realistisch einzuschätzen und dem Mandanten ehrlich mitzuteilen. Dazu muss er den geschilderten Sachverhalt gründlich juristisch würdigen – inklusive relevanter Gesetze und Gerichtsentscheidungen – und klar sagen, ob das gewünschte Ziel erreichbar ist. Bestehen nur geringe Aussichten auf Erfolg, muss der Anwalt dies unmissverständlich herausstellen. Er darf in einem praktisch aussichtslosen Fall nicht beschönigend behaupten, die Erfolgschancen seien „offen“ oder 50/50. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Anwalt in solchen Situationen von der Klage abrät – unterlässt er diesen Hinweis, verletzt er seine Beratungspflicht fahrlässig. (Beispiel: In einem Fall vor dem OLG Koblenz verfolgte ein Anwalt trotz klar entgegenstehender BGH-Rechtsprechung eine nahezu aussichtslose Klage weiter. Er informierte den Mandanten nicht über die praktisch fehlenden Erfolgsaussichten. Das Gericht stellte darin eine erhebliche Verletzung der Beratungspflicht und einen Haftungsfall fest.)*
- Hinweis auf alternative Strategien: Zur umfassenden Beratung gehört es auch, alternative Vorgehensweisen aufzuzeigen. Der Anwalt muss von sich aus Möglichkeiten in Betracht ziehen, die der Mandant vielleicht nicht kennt, die aber zu einem besseren Ergebnis führen könnten. Beispiel: Rät ein Mandant zu einer Vertragsauflösung, muss der Anwalt prüfen, ob z.B. Schadensersatzansprüche eine vorteilhaftere Lösung wären, und diesen Weg von sich aus vorschlagen. Im erwähnten BGH-Fall aus 1994 etwa hätten die Anwälte ihrer Mandantin statt nur der Vertragsrückabwicklung Schadensersatz wegen Nichterfüllung als weit profitablere Option empfehlen müssen. Unterlässt der Anwalt solche Hinweise und wählt einfach den vom Mandanten gewünschten, aber suboptimalen Weg, macht er sich schadensersatzpflichtig.
- Aufklärung über Kosten und Prozessrisiken: Der Anwalt muss den Mandanten – spätestens auf Nachfrage – über die voraussichtlichen Kosten eines Verfahrens und die finanziellen Risiken eines Unterliegens informieren. Dazu zählen die eigenen Anwalts- und Gerichtskosten sowie ggf. die der Gegenseite. Der Mandant soll die wirtschaftlichen Konsequenzen eines Rechtsstreits vollständig verstehen, bevor er sich dafür entscheidet. Eine unzureichende Aufklärung über die Kostenrisiken (etwa wenn der Anwalt das Risiko einer Kostenpflicht bei Niederlage verharmlost oder verschweigt) kann ebenfalls eine Haftung des Anwalts begründen. Rechtsschutzversicherung: Selbst wenn der Mandant eine Rechtsschutzversicherung hat, entbindet eine Deckungszusage den Anwalt nicht von dieser Aufklärungspflicht. Auch bei Übernahme der Prozesskosten muss der Anwalt den Mandanten über Erfolgsaussichten, Risiken und mögliche Schadensersatzansprüche umfassend beraten – anderenfalls droht ihm ebenfalls der Regress.
- Auswahl des richtigen Gegners: Zu den Beratungspflichten gehört weiter, den richtigen Anspruchsgegner für die Forderungen des Mandanten zu ermitteln. Der Anwalt darf sich nicht blind auf die Angaben des Mandanten verlassen, wer verantwortlich sei, sondern muss eigenständig prüfen, gegen wen Ansprüche rechtlich durchsetzbar sind. Gerade wenn mehrere Personen oder Gesellschaften in Betracht kommen, hat der Anwalt den Mandanten darüber zu beraten, welche Beteiligten als Gegner in Frage kommen und ob es ratsam ist, gegen alle potentiell Haftenden oder nur einzelne vorzugehen. Versäumt der Anwalt dies und verklagt er etwa nur den falschen (nicht haftenden) Gegner, riskiert er, dass berechtigte Ansprüche gegen den eigentlich Verantwortlichen verjähren – mit der Konsequenz, dass er dem Mandanten den entstandenen Schaden ersetzen muss. (Beispiel: In einem BGH-Fall von 2005 verklagten Anwälte irrtümlich einen Mitarbeiter und die Anwälte eines Unternehmens statt das Unternehmen selbst – der Anspruch gegen den richtigen Schuldner verjährte und die Anwälte wurden haftbar gemacht.)* Der erste Schritt eines jeden Mandats sollte daher die korrekte Gegneridentifizierung sein.
- Wahrung von Fristen und Sorgfaltspflichten: Neben der inhaltlichen Beratung hat der Anwalt strikte Sorgfaltspflichten. Besonders zentral ist die Überwachung und Einhaltung aller Fristen (Verjährungsfristen, Klage- und Rechtsmittelfristen etc.). Versäumt ein Anwalt wichtige Fristen, drohen dem Mandanten schwerwiegende Rechtsnachteile – etwa der endgültige Verlust eines Anspruchs – was fast immer zu einem Haftungsfall führt. Ebenso muss der Anwalt alle notwendigen verfahrensrechtlichen Schritte korrekt durchführen (z.B. Einlegung von Rechtsmitteln beim richtigen Gericht, vollständiger Sachvortrag etc.). Fehler wie eine Klage bei unzuständigem Gericht oder ein unzureichend substantiierter Sachvortrag können den Prozess aus formalen Gründen scheitern lassen. In solchen Fällen hat der Mandant regelmäßig einen Schadensersatzanspruch, da ein sachlicher Erfolg vereitelt wurde, weil der Anwalt seine vertraglichen Pflichten verletzt hat.
- Informations- und Rechenschaftspflichten: Während der Mandatsdauer schuldet der Anwalt dem Mandanten laufend Auskunft über den Stand des Verfahrens und Rechenschaft über sein Tätigwerden. Der Mandant ist über wesentliche Entwicklungen unaufgefordert zu informieren – z.B. den Eingang von Zahlungen im Rahmen des Falls, den Ausgang von wichtigen Verfahrensschritten oder Vergleichsangebote der Gegenseite. Auf Verlangen des Mandanten muss der Anwalt zudem jederzeit Auskunft über den Fortgang erteilen. Teil dieser Pflicht ist es auch, den Mandanten über alle beim Anwalt eingehenden Gelder im Zusammenhang mit dem Mandat sofort zu informieren (etwa eingehende Schadensersatzzahlungen).
- Umfassende Sachverhaltsaufklärung und Vorbereitung: Ein Anwalt muss den Sachverhalt vollständig aufklären und alle relevanten Informationen vom Mandanten einholen, um den Fall korrekt bearbeiten zu können. Er hat vor jedem rechtlichen Schritt eine sorgfältige rechtliche Prüfung der Sach- und Rechtslage durchzuführen. Dazu gehört auch, das Gericht umfassend und wahrheitsgemäß über die Rechtslage und den Sachverhalt zu informieren – unterlässt er z.B. die Darstellung entscheidungserheblicher Fakten oder Rechtsgrundlagen, kann der Mandant den Prozess verlieren. Letztlich wird der Anwalt seiner Rolle als „Berater“ des Mandanten nur gerecht, wenn er all diese Voraussetzungen gewissenhaft erfüllt.
- Vorbereitung von Vergleichen: Gerade bei Vergleichsverhandlungen hat der Anwalt eine gesteigerte Aufklärungspflicht. Er muss den Mandanten über die Vor- und Nachteile eines Vergleichs gegenüber einer gerichtlichen Entscheidung aufklären – einschließlich der endgültigen Wirkung eines Vergleichs. Der Mandant muss wissen, dass ein geschlossener Vergleich den Rechtsstreit abschließend beendet und weitere Ansprüche ausschließt. Versäumt der Anwalt, auf solche endgültigen Konsequenzen hinzuweisen, und der Mandant stimmt unwissend einem nachteiligen Vergleich zu, kann darin wiederum eine haftungsrelevante Beratungslücke liegen.
Zwischenfazit: Die Anforderungen an die anwaltliche Beratung und Aufklärung sind sehr hoch. Der Anwalt muss nicht nur die rechtlichen Erfolgsaussichten, sondern auch die wirtschaftlichen und strategischen Aspekte eines Vorgehens sorgfältig abwägen und den Mandanten entsprechend informieren. Nur durch eine umfassende, verständliche und an den Bedürfnissen des Mandanten orientierte Beratung kann der Anwalt seiner Verantwortung gerecht werden. Verletzt er eine dieser Pflichten, macht er sich unter Umständen schadenersatzpflichtig.
Grenzen der Aufklärungspflicht: Was muss der Anwalt nicht wissen?
Trotz der weitreichenden Beratungs- und Informationspflichten gibt es auch Grenzen, was von einem Anwalt verlangt werden kann. Die Rechtsprechung betont, dass einem Rechtsanwalt zwar hohe Anforderungen an Kenntnisse und Sorgfalt abverlangt werden, er aber nicht allwissend sein muss. Insbesondere muss der Anwalt keine Tatsachenkenntnisse außerhalb seines Mandatsbereichs haben, sofern sie für die juristische Beratung nicht erforderlich sind.
Beispielsweise trifft einen normal beauftragten Anwalt nicht ohne Weiteres die Pflicht, den Mandanten vor einer möglichen Insolvenz eines Vertragspartners zu warnen, wenn hierfür keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen. Handelt es sich um wirtschaftliche Informationen, die für den Anwalt nicht offensichtlich und nicht Teil der Rechtsberatung sind (etwa die im Hintergrund drohende Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens), so muss der Anwalt solche Informationen grundsätzlich nicht von sich aus ermitteln. Anders liegt der Fall, wenn konkrete Hinweise auf ein Risiko bestehen oder der Anwalt ausdrücklich mit der Bewältigung einer solchen Krisensituation beauftragt wurde. Dann erweitert sich sein Pflichtenkreis: Wird ein Anwalt z.B. speziell zur Beratung in einer Unternehmenskrise mandatiert, muss er den Mandanten ungefragt auf etwaige Insolvenzantragspflichten hinweisen, sofern sich solche Pflichten im Mandatsverlauf erkennbar aufdrängen. Im Allgemeinen gilt jedoch: Ein Anwalt darf zunächst auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen vertrauen, die ihm der Mandant liefert – solange keine Hinweise vorliegen, dass diese Angaben lückenhaft oder falsch sein könnten. Er ist nicht verpflichtet, ohne Anlass auf eigene Faust über das vom Mandanten Gelieferte hinaus Nachforschungen zu jedem erdenklichen Aspekt anzustellen.
Hier zeigt sich die Wechselwirkung zwischen Mandant und Anwalt: Der Mandant muss den Anwalt wahrheitsgemäß und vollständig über den Sachverhalt informieren, während der Anwalt auf Basis dieser Informationen rechtlich berät. Natürlich sollte ein Anwalt bei Unklarheiten gezielt nachfragen – seine Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung umfasst das aktive Erfragen relevanter Punkte. Doch wenn der Mandant wichtige Tatsachen von sich aus verschweigt oder selbst nicht kennt und es keine offensichtlichen Hinweise darauf gibt, kann dem Anwalt nicht jede Fehlprognose angelastet werden. Grundsatz: Gefordert ist eine mandatsbezogene umfassende Rechtskenntnis und Sorgfalt. Kenntnisse in fachfremden Bereichen oder das Hellsehen versteckter Risiken gehören nicht zu den Pflichtaufgaben, solange der Anwalt keine konkreten Warnsignale hat, die er ignoriert.
Typische Fehler, die zur Anwaltshaftung führen
In der Praxis zeigt sich eine Reihe wiederkehrender Fehler von Anwälten, die häufig Gegenstand von Haftungsfällen sind. Die wichtigsten Fehlerquellen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Versäumnis von Fristen: Das Nichtwahren von Klagefristen, Rechtsmittelfristen oder Verjährungsfristen ist eine der häufigsten Ursachen für Anwaltshaftungsfälle. Verpasst der Anwalt etwa die rechtzeitige Klageeinreichung vor Eintritt der Verjährung oder übersieht er eine Berufungsfrist, verliert der Mandant unwiederbringlich seine Rechte. Solche Versäumnisse führen nahezu automatisch zur Haftung, denn der Kausalzusammenhang zum Schaden (Verlust des Anspruchs) liegt auf der Hand. Der Anwalt muss dann dem Mandanten den vollen entstandenen Schaden ersetzen, z.B. den entgangenen Anspruchswert.
- Klage gegen den falschen Beklagten: Ein weiterer klassischer Anwaltsfehler ist die falsche oder unvollständige Wahl der Anspruchsgegner. Richtet der Anwalt die Klage nicht gegen den wirklich haftenden Schuldner oder vergisst er, alle Verantwortlichen einzubeziehen, kann der Mandant allein deshalb den Prozess verlieren. In der Konsequenz erleidet der Mandant meist einen doppelten Schaden: Er trägt die Prozesskosten des verloren gegangenen Verfahrens und kann gegen den eigentlich Schuldigen ggf. nichts mehr ausrichten (etwa wegen Verjährung). Der Anwalt haftet dann für sämtliche finanzielle Nachteile, die dem Mandanten dadurch entstanden sind.
- Fehlerhafte Erfolgseinschätzung / fehlende Risikoaufklärung: Wie oben dargelegt, ist es essenziell, dass der Anwalt die Erfolgschancen realistisch darstellt und vor Risiken warnt. Tut er dies nicht, läuft der Mandant u.U. in ein aussichtsloses Verfahren oder übernimmt ein untragbares Kostenrisiko – in der Erwartung, vom Anwalt anders beraten worden zu sein. Versäumnisse in der Aufklärungspflicht (z.B. das Verschweigen einer bestehenden negativen Rechtsprechung oder das Unterlassen des Rates, von einer klage abzusehen) berechtigen den Mandanten zum Schadensersatz, wenn er aufgrund der unvollständigen Information eine nachteilige Entscheidung getroffen hat. So musste etwa ein Anwalt haften, der seinem Mandanten zu einer praktisch aussichtslosen Klage riet: Der Mandant hätte den Prozess bei korrekter Aufklärung gar nicht erst geführt und somit Kosten gespart.
- Unzureichende Sachverhaltsaufbereitung: Auch handwerkliche Fehler in der Prozessführung können haftungsauslösend sein. Trägt der Anwalt den Sachverhalt vor Gericht unzureichend vor – z.B. weil er wichtige Dokumente oder Beweise nicht rechtzeitig vorlegt oder den Sachverhalt nur lückenhaft schildert – wird die Klage ggf. als unsubstantiiert abgewiesen. In einem solchen Fall liegt der Schaden des Mandanten (Verlust des Prozesses) in der Sphäre des Anwalts. Ebenso kann die Nichtbeachtung von Instruktionen des Mandanten (etwa bestimmte Zeugen zu benennen oder Vergleichsangebote zu unterbreiten) zu Haftungsfällen führen, wenn dem Mandanten daraus ein Nachteil erwächst.
Diese Beispiele zeigen: Anwaltliche Fehler können entweder dazu führen, dass der Rechtsstreit verloren geht (und der Mandant auf den Kosten und in der Sache leer ausgeht), oder dass Ansprüche des Mandanten untergehen, ohne dass eine gerichtliche Entscheidung in der Sache ergeht. Juristisch unterscheidet man hier oft zwischen dem Prozesskostenschaden und dem Hauptsachenschaden. Der Prozesskostenschaden umfasst die unnötig aufgewendeten Prozesskosten (Gerichtsgebühren, Anwaltskosten, gegnerische Kostenerstattung) in einem Verfahren, das bei korrekter Beratung so nicht geführt worden wäre. Der Hauptsacheschaden bezeichnet den Verlust des eigentlichen Anspruchs des Mandanten, z.B. weil dieser wegen Fristversäumnis nicht mehr durchgesetzt werden kann. In vielen Fällen treten beide Schadensarten kombiniert auf. Wichtig: Der Mandant muss dem Anwalt den entstandenen Schaden zurechnen können – d.h. nachweisen, dass er bei pflichtgemäßem Verhalten des Anwalts den Schaden nicht erlitten hätte. Hier kommt ihm der sogenannte Anscheinsbeweis zugute: Nach gefestigter Rechtsprechung wird vermutet, dass ein Mandant sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung anders entschieden hätte. Beispielsweise geht man davon aus, dass der Mandant eine aussichtslose Klage nicht geführt hätte, wenn der Anwalt ihn korrekt über die minimalen Erfolgschancen aufgeklärt hätte. Dieser Anscheinsbeweis erleichtert dem Mandanten die Durchsetzung von Haftungsansprüchen. Der Anwalt kann die Vermutung nur entkräften, indem er konkret beweist, dass der Mandant auch bei vollständiger Aufklärung denselben Weg gewählt hätte – was in der Praxis selten gelingt.
Beweislast, Dokumentation und Versicherungsschutz
Da im Haftungsprozess oft Aussage gegen Aussage steht, trifft den Anwalt eine besondere Obliegenheit, seine Beratungstätigkeit gut zu dokumentieren. Kommt es zum Streit, muss der Anwalt im Zweifel nachweisen, dass er seinen Pflichten nachgekommen ist. Der BGH hat klargestellt, dass Unklarheiten in der Beratung zulasten des Anwalts gehen können, wenn er keine ausreichenden Aufzeichnungen vorlegt. Daher ist es für Anwälte unerlässlich, Inhalte von Beratungsgesprächen, Warnhinweise und Empfehlungen schriftlich festzuhalten. Eine lückenlose Dokumentation – etwa durch Aktenvermerke oder schriftliche Beratungsbriefe – schützt nicht nur den Anwalt, sondern stellt auch für den Mandanten Transparenz her. Im Ernstfall kann eine gute Dokumentation entscheidend dazu beitragen, den Anscheinsbeweis zu entkräften und zu zeigen, dass der Mandant umfassend informiert war.
Sollte tatsächlich ein Haftungsfall eintreten, sind Mandanten in Deutschland nicht schutzlos gestellt. Jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung (Vermögensschaden-Haftpflicht) abzuschließen, die berechtigte Schadensersatzansprüche abdeckt. Diese Versicherung tritt im Haftungsfall ein und sorgt dafür, dass der Mandant seinen Schaden ersetzt bekommt – zumindest bis zur Deckungssumme der Police. (Hinweis: Bei sehr hohen Streitwerten kann es ausnahmsweise Deckungslücken geben; Mandanten sollten bei größeren Fällen im Zweifel nachfragen, ob die Versicherungssumme des Anwalts ausreicht.) Außerdem verjähren Ansprüche aus Anwaltshaftung innerhalb von drei Jahren. Die Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Mandant von dem Schadensfall und der Person des Anwalts als Anspruchsgegner Kenntnis erlangt (oder grob fahrlässig keine Kenntnis hatte). Mandanten, die den Verdacht haben, durch einen Anwaltsfehler geschädigt worden zu sein, sollten daher zeitnah rechtlichen Rat einholen, um ihre Ansprüche zu prüfen und innerhalb der Frist durchzusetzen.
Fazit
Die Aufklärungspflichten des Rechtsanwalts dienen dem Schutz des Mandanten. Der Mandant soll durch umfassende Beratung vor rechtlichen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen bewahrt werden. Ein gewissenhaft arbeitender Anwalt wird daher stets alle Handlungsoptionen, Risiken und Kostenfolgen mit dem Mandanten besprechen und gemeinsam den sinnvollsten Weg wählen. Darüber hinaus hat er die formalen Pflichten – von Fristen über Zuständigkeiten bis zur vollständigen Sachverhaltsaufklärung – sorgfältig zu erfüllen, um die Interessen seines Mandanten optimal zu wahren. Fehler können in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld zwar passieren, doch wo sie auf Vernachlässigung der Anwaltspflichten beruhen, steht dem Mandanten ein Ausgleich zu. Die Gerichte stellen hohe Anforderungen an die anwaltliche Beratung und gewähren im Zweifel dem Mandanten Recht, wenn der Anwalt seine Pflichten nicht nachweisen kann. Mandanten dürfen also erwarten, umfassend und ehrlich aufgeklärt zu werden – und Anwälte tun gut daran, dieser Verpflichtung mit größter Sorgfalt nachzukommen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Letztlich ist eine offene, gründliche Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant der beste Garant dafür, dass Rechtsberatung erfolgreich verläuft und Haftungsfälle gar nicht erst entstehen.
Quellen: Die dargestellten Grundsätze entsprechen der aktuellen obergerichtlichen Rechtsprechung und Fachliteratur zur Anwaltshaftung, u.a. Entscheidungen des BGH zur anwaltlichen Beratungspflicht, Fachbeiträge von Rechtsanwälten für Anwaltshaftungsrecht sowie praxisorientierten Leitfäden zur Vermeidung von Anwaltspflichtverletzungen. Die Beispiele und Erläuterungen wurden anhand veröffentlichter Fälle (OLG Koblenz u.a.) und Expertenkommentaren (RA Spirgath, Mathias Nittel, Dr. Fiala etc.) erstellt, welche die Umfang und Grenzen der Aufklärungspflicht veranschaulichen.